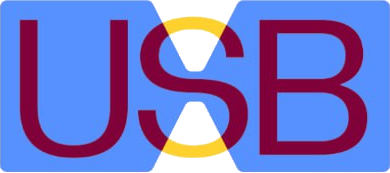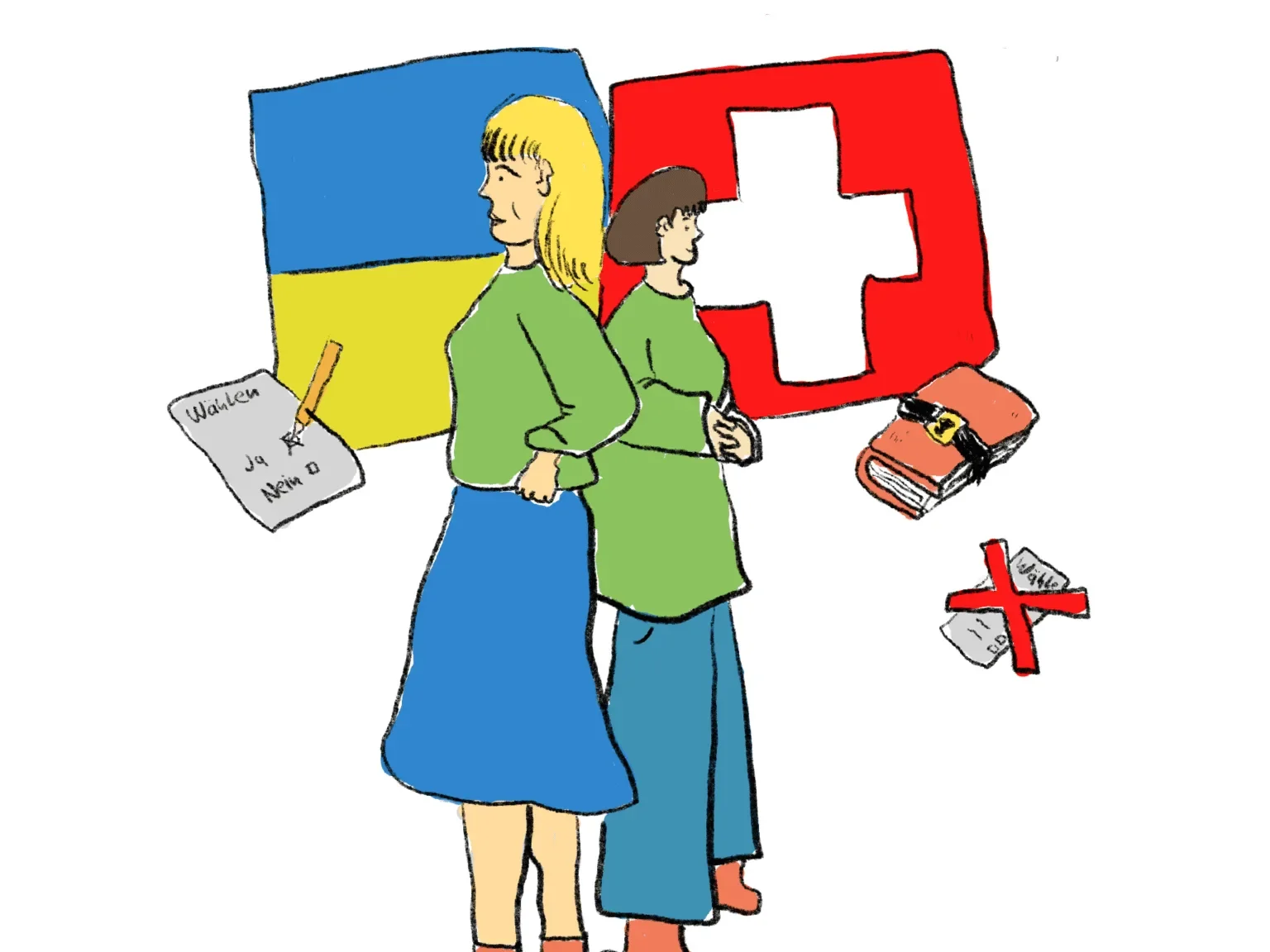Eine zufällige Reise in die Schweiz
Der Krieg begann in Polen, als Daria Mazurok sich im Land befand. Sie hatte vor, nach Hause zurückzukehren, doch ihr Weg nahm eine andere Wendung: Dank Freiwilliger landete das Mädchen aus Charkiw in der Schweiz, wo sie blieb. In ihrer Heimatstadt betrieb die Frau ein eigenes Reinigungsunternehmen. Sie arbeitete selbstständig und beauftragte ihre Freunde nur bei Großaufträgen.
Schwierige Integration und erste Enttäuschungen
Die ersten zwei Jahre in der Schweiz waren eine echte Herausforderung. Die Jobsuche war oft von Missverständnissen mit Arbeitgebern begleitet: von unrechtmäßigen Lohnabzügen bis hin zu Überarbeitung durch Überstunden. „Ich war buchstäblich völlig überfordert. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme“, gibt die Frau zu.
Soziale Medien oder RAV?
Nach einer negativen Erfahrung mit der Sozialhilfe, die zu Schulden von 6700 Franken führte, lehnte Daria Sozialhilfe grundsätzlich ab. Stattdessen wandte sie sich an das RAV (Arbeitsamt). „Sie helfen bei der Arbeitssuche und zahlen während der Arbeitssuche Leistungen. So kann man sich über Wasser halten“, erklärt die Ukrainerin.
Kurse und Unterstützung
Der entscheidende Moment waren die Kurse von RAV: ein dreimonatiger Deutschkurs zur Kommunikation mit Arbeitgebern und zum Verfassen von Bewerbungsunterlagen. „Wir hatten von 8 bis 16 Uhr Vorlesungen. Dort habe ich nicht nur mein Deutsch verbessert, sondern auch Selbstvertrauen gewonnen. Die Lehrer und die Gruppe waren eine echte Unterstützung für mich. Und ich habe dort auch Freunde gefunden“, sagt Daria.
Nach den Kursen bestand die Frau den offiziellen Sprachtest: schriftliches Niveau B1, mündliches Niveau A2 und konnte bereits Vorstellungsgespräche auf Deutsch führen. Dies wurde zum Schlüssel für einen neuen Job.
Die Jobsuche ist nicht einfach, aber notwendig
Unter Ukrainern herrscht oft die Angst, dass RAV einen zwingt, jedes Jobangebot anzunehmen. Der Interviewpartner sagt: „Ihre Aufgabe ist es, Sie auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Wenn Sie das Angebot ablehnen, können sie Sie natürlich aus dem Programm nehmen. Wenn die Bedingungen inakzeptabel sind oder der potenzielle Arbeitgeber nicht richtig mit Ihnen kommuniziert, liegt die Entscheidung bei Ihnen.“
Daria nennt ein Beispiel: Sie scheiterte bei einer Stelle, bei der ausschließlich Portugiesen arbeiteten, weil sie kein Portugiesisch sprach. Trotz der mangelnden Sprachkommunikation stimmte die Frau einem Schnuppertag zu. Danach kam es jedoch nicht mehr zu einem Gespräch mit dem Firmenchef. Auch später erhielt Daria keine Antwort. Es zeigte sich, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt hatte, den Job aber nicht bekam.
Sprache als Schlüssel
Ein weiterer Mythos: Ukrainer mit A2- oder B1-Niveau würden die RAV-Spezialisten „nicht verstehen“. Tatsächlich passen die Berater die Sprache an das jeweilige Sprachniveau an. „Zuerst habe ich einen Dolmetscher mitgenommen, aber eines Tages kam ich ohne und habe alles verstanden. Bei Unklarheiten kann man jederzeit nachfragen oder einen Dolmetscher am Telefon hinzuziehen. Es ist wichtig, sich selbst zu verständigen“, sagt die Frau.
„Akzeptiere die Spielregeln“
Die wichtigste Lektion, die Daria aus ihrer Erfahrung mit Rav gelernt hat: Die Schweiz hat ihre eigenen Regeln, und man muss sie akzeptieren. „Ich habe mich gewehrt und allen um mich herum bewiesen, dass sie Unrecht hatten, aber es hat mich nicht geschafft“, gibt die Frau zu. „Als mir klar wurde, dass ich nach den Gesetzen und Regeln dieses Landes und der Organisationen leben muss, an die ich mich wende, wurde alles einfacher. Dann begannen sich Türen zu öffnen.“